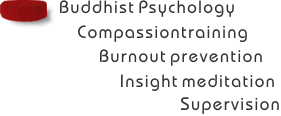Schweigen ist nicht immer Gold
Schweigen ist nicht immer Gold
Ein offener Brief zum Umgang mit einer humanitären Katastrophe
Es wird niemandem entgangen sein, dass sich derzeit in Gaza eine schreckliche humanitäre Tragödie abspielt. Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Es herrscht ein enormer Mangel an Medikamenten, Lebensmitteln und Trinkwasser, und sie sprechen von einer akuten Notlage. Trotz dieser alarmierenden Lage setzt das israelische Regime unter Premierminister Netanjahu seine Politik der ethnischen Säuberung und des Völkermords unvermindert fort. Leider schweigt die niederländische Regierung weitgehend und wagt es immer noch nicht, sich ausdrücklich gegen diese Politik auszusprechen. Tatsächlich gibt es wirtschaftliche, politische und militärische Unterstützung. Auch kritische Stimmen aus der buddhistischen (und auch der säkularen Achtsamkeits-)Welt bleiben bislang weitgehend aus. Schweigen angesichts groß angelegter Ungerechtigkeit oder Gewalt kann zu deren Normalisierung beitragen und die Position der Unterdrücker stärken. Indem wir nicht unsere Stimme erheben, legitimieren wir implizit Ungerechtigkeit – und machen uns durch Unterlassung mitschuldig.
Mit diesem Artikel möchten wir unterstreichen, dass eine buddhistische Haltung gegenüber Ungerechtigkeit auch bedeuten kann, dass wir uns kritisch äußern und dass es nicht immer ausreicht, einfach „ohne zu urteilen beiseite zu stehen”.
Dabei möchten wir ausdrücklich betonen, dass unsere Kritik nicht gegen alle Juden oder Israelis gerichtet ist, sondern speziell gegen die völkermörderische Politik der israelischen Regierung unter Netanjahu.1
Vor dem Hintergrund einer enormen Informationsflut möchten wir zunächst ein zusammenfassendes Bild des Leidens in Gaza zeichnen. Dazu verwenden wir vier Kernpunkte, die den vier edlen Wahrheiten des Buddhismus entsprechen.2 Der erste Kernpunkt ist die Anerkennung, dass Völkermord stattfindet. Als zweiten Kernpunkt untersuchen wir die Ursachen dieses Völkermords und die Ursachen für das schmerzhafte Schweigen darüber in der westlichen Welt, einschließlich der Niederlande. In diesem Zusammenhang untersuchen wir auch, warum selbst aus buddhistischen Kreisen, insbesondere aus der Vipassanā-Tradition, wie sie vom burmesischen Mönch Mahāsi Sayadaw (†1982) gelehrt wurde, so wenige kritische Stimmen zu hören sind. Der dritte Kernpunkt konzentriert sich auf die Perspektive: die Möglichkeit eines Waffenstillstands und einer gewaltfreien Koexistenz eines israelischen und eines palästinensischen Staates. Als vierten wichtigen Punkt befassen wir uns schließlich damit, wie wir als Meditierende diesen Völkermord betrachten können und wie wir in einer leidvollen Welt gewaltfreie „Mitgefühl in Aktion” praktizieren können.
1. In Gaza findet ein dramatischer Völkermord statt
Am 7. Oktober 2023 verübte die Hamas einen Terroranschlag in Israel, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und etwa 250 als Geiseln genommen wurden. Diese Gewalttat ist zweifellos zu verurteilen, und natürlich hatte Israel das Recht, sich zu verteidigen. Dennoch war und ist die Reaktion des israelischen Regimes und der Armee völlig unverhältnismäßig.
Über anderthalb Jahre später liegt die Zahl der Todesopfer in Gaza bei über 55.0003, während eine Veröffentlichung in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet im vergangenen Jahr darauf hinwies, dass die tatsächliche Zahl der palästinensischen Opfer wahrscheinlich viel höher ist, wobei Frauen und Kinder einen sehr hohen Anteil ausmachen.4 Mehr als 100.000 Menschen sind verletzt und die meisten Krankenhäuser und Schulen wurden zerstört – viele unter dem Vorwand, dass sich dort Hamas-Kämpfer aufhalten könnten. Mehr als eine Million Menschen sind nun obdachlos, und die Infrastruktur Gazas ist fast vollständig zerstört.
Die humanitäre Katastrophe ist allumfassend und hat den Charakter einer ethnischen Säuberung, bei der Hunger als Waffe eingesetzt wird. Eine bemerkenswerte und umstrittene Rolle spielt dabei die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), eine Initiative der Vereinigten Staaten und des israelischen Regimes, die Anfang dieses Jahres zur Koordinierung der Hilfsmaßnahmen ins Leben gerufen wurde. Traditionelle Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen argumentieren, dass diese Hilfe kaum angekommen ist, und weigern sich, mit der GHF zusammenzuarbeiten, da sie grundlegende Kriterien wie Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit nicht erfüllt. Kritiker sehen in dem Plan ein strategisches Mittel, um die palästinensische Bevölkerung zur Flucht in den Süden Gazas zu zwingen; schließlich befinden sich drei der vier Verteilungsstellen im Süden.
Anfang Juli kam eine UN-Kommission zu dem Schluss, dass Israel sich der „Auslöschung palästinensischen Lebens in Gaza“ schuldig gemacht hat. Dabei stufte sie den Einsatz von Lebensmitteln als Waffe gegen Zivilisten in Gaza als Kriegsverbrechen ein.
2.1. Ursachen des Völkermords in Gaza
Der Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023 war ein traumatisches Ereignis, das ohne Frage zu verurteilen ist. Viele Quellen betonen jedoch, dass dieser Anschlag vor dem Hintergrund einer langjährigen Unterdrückung des palästinensischen Volkes stattfand. In diesem Zusammenhang wird regelmäßig der Begriff „Apartheid“ verwendet; Amnesty International behauptet, die israelische Regierung verfolge eine Politik der möglichst weitgehenden Bevorzugung jüdischer Israelis in den besetzten Gebieten. Diese Politik hat zu struktureller Rassendiskriminierung geführt, die sogar gesetzlich verankert ist. So können palästinensische Einwohner Israels oft keine israelische Staatsbürgerschaft erhalten und haben daher einen anderen Rechtsstatus als jüdische Israelis. Palästinenser, die in Gaza und im Westjordanland leben, sind in vielen Fällen staatenlos. Sie dürfen sich in weiten Teilen des Landes nicht frei niederlassen, und dort, wo sie leben, fehlen oft angemessene Einrichtungen. Diese strukturelle Ungleichheit hat zu wirtschaftlicher Not und sozialer Ausgrenzung geführt. Die Hamas ist daher nicht aus dem Nichts entstanden, sondern zum Teil aus jahrzehntelanger Ungerechtigkeit und Frustration über die ausweglose Situation hervorgegangen.
Gleichzeitig muss betont werden, dass keineswegs alle Bewohner Gazas die Hamas unterstützen. Tatsächlich befindet sich die Bevölkerung ohne eigenes Verschulden in diesem Konflikt zwischen zwei Kriegsparteien und ist somit das größte Opfer dieser Situation.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die expansionistische Politik Israels, die sich nicht auf den Gazastreifen beschränkt, sondern auch im Westjordanland sichtbar wird. Premierminister Netanjahu hat sich im Laufe der Jahre zu einem Führer entwickelt, der unter dem Vorwand des anhaltenden Kriegszustands seine Machtposition zu behaupten vermag. Es war auch Netanjahu, der den gerade erst Anfang dieses Jahres vereinbarten Waffenstillstand einseitig gebrochen hat. Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) hat nun sowohl Netanjahu, den ehemaligen Verteidigungsminister Gallant als auch den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri5 wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Dennoch scheinen viele westliche Länder diese Vorwürfe kaum ernst zu nehmen.
2.2. Ursachen des Schweigens
Trotz der extremen Gewalt in Gaza bleiben die USA und viele europäische Länder auffällig still. Auch die niederländische Regierung äußert sich kaum.
Woher kommt dieses bemerkenswerte Schweigen? Dafür gibt es mehrere mögliche Erklärungen. Erstens spielt bei einigen traditionell christlichen Parteien ein alter biblischer Glaube eine Rolle, wonach das Land Kanaan – einschließlich Gaza – als das „Gelobte Land” angesehen wird, das Gott Abraham und seinen Nachkommen zugeteilt hat. Diese religiöse Vorstellung nährt eine starke, bedingungslose Loyalität gegenüber Israel. In diesem Licht wird Kritik an Israel schnell als antisemitisch abgestempelt, wodurch Raum für differenzierte oder berechtigte Kritik effektiv verschlossen wird.
Darüber hinaus ist nach den Schrecken des Holocaust eine tiefe Sympathie für das jüdische Volk entstanden, was völlig verständlich ist. Gleichzeitig ist es schmerzlich zu sehen, wie diese Sympathie manchmal dazu benutzt wird, gewalttätige Politik zu billigen und zu akzeptieren, wie die historische Opferrolle sich in eine Täterrolle verkehrt.
Auch wirtschaftliche Interessen und Verflechtungen mit Israel, selbst auf Universitätsebene, dürfen nicht unterschätzt werden. Darüber hinaus ist seit den Anschlägen auf die Twin Towers am 11. September 2001 in weiten Teilen der westlichen Welt eine tiefsitzende Angst vor und Widerstand gegen den Islam entstanden. Die europäischen Länder haben nach dem Einmarsch in die Ukraine schnell Stellung gegen Russland bezogen, schweigen aber, wenn ein islamisches Volk wie die Palästinenser langsam aber sicher ausgerottet wird.
Amerika unterstützt Netanjahu weiterhin, vermutlich aus wirtschaftlichen und strategischen Interessen. Viele europäische Nationen folgen der amerikanischen Position fast automatisch, als wäre sie ein älterer Bruder, dessen Beispiel man blind folgt.
Darüber hinaus spielt möglicherweise auch soziale Angst eine Rolle. Die Menschen haben Angst, des Antisemitismus bezichtigt zu werden, oder wollen keine Konflikte mit Andersdenkenden in ihrem Familien- oder Freundeskreis. In diesem Zusammenhang wird auch häufig der sogenannte Whataboutismus eingesetzt. Kritik an Israel wird dann nicht inhaltlich beantwortet, sondern mit Fragen wie „Was ist mit der Hamas?“ oder „Warum konzentriert man sich auf Gaza und nicht auf andere Konflikte in der Welt?“ abgelenkt. Auf diese Weise wird die ursprüngliche Kritik nicht ernst genommen, sondern trivialisiert oder neutralisiert.
Schließlich kann auch kollektives Trauma das Schweigen in der Gesellschaft beeinflussen. In Familien von Kriegsveteranen ist es oft üblich, nicht über Kriegserlebnisse zu sprechen, weil diese schmerzhafte Erinnerungen wachrufen. Dieser Mechanismus kann sich in größerem Maßstab wiederholen und dazu führen, dass wir in einer Kultur leben, in der Schweigen gegenüber dem Aussprechen schwieriger Wahrheiten bevorzugt wird.6
2.3. Schweigen in der buddhistischen Welt
Ein bemerkenswertes Schweigen ist auch in vielen buddhistischen Gemeinschaften zu beobachten, darunter auch in der Vipassanā-Tradition, der wir selbst angehören. Dieses Schweigen steht im Gegensatz zu dem Engagement, das früher gegenüber Missständen wie in Myanmar gezeigt wurde. Wie lässt sich das erklären? Nach einiger Überlegung kommen wir zu sieben möglichen Ursachen – von denen wir einige auch bei uns selbst als Fallstricke oder allmählich wachsende blinde Flecken erkennen.
Erstens gibt es die Entstehung eines nicht-religiösen Ansatzes der Achtsamkeit, dessen Wert unbestreitbar ist. Pioniere wie Jon Kabat-Zinn und Mark Williams haben wichtige Beiträge zur Integration von Achtsamkeit in das Gesundheitswesen und die Bildung geleistet, unter anderem durch Programme wie MBSR und MBCT. Dank ihrer Arbeit haben unzählige Menschen mit körperlichen oder psychischen Beschwerden von dieser Praxis profitiert. Diese Entwicklung hat jedoch auch dazu geführt, dass der Begriff „Achtsamkeit” in der Öffentlichkeit öfter mit Entspannung und Selbstregulierung assoziiert wird als mit Ethik und mitfühlendem Engagement.
Ein zweiter Grund ist das Ideal der Gleichmut, das sowohl in der säkularen Achtsamkeitskultur als auch in buddhistischen Traditionen als wichtiges Ziel hochgehalten wird. In dieser Hinsicht gilt Buddha als Inbegriff der nicht wertenden Achtsamkeit. Daraus wird oft abgeleitet, dass die Probleme im Nahen Osten zu komplex seien, um sie zu beurteilen. Daher sei es am besten, dem buddhistischen Mittelweg zu folgen und sich nicht in die Politik einzumischen, und einige Lehrer halten sich sehr streng daran. Diese Argumentation verkennt jedoch, dass alle unsere körperlichen, verbalen und mentalen Handlungen politische Dimensionen haben. Ethisches Handeln, einschließlich der Einschränkung unserer selbst oder anderer, kann tatsächlich Ausdruck von Weisheit und Mitgefühl sein. Indem wir angeblich unpolitisch sein und keine Urteile fällen wollen, betreiben wir in Wirklichkeit Politik – und machen uns durch unser Schweigen mitschuldig.
Ein dritter Grund könnte in der Sorge liegen, dass Wut etwas Negatives ist. Viele Praktizierende sehen Wut als etwas Niedriges oder Ungesundes, als etwas, das nicht zu einer spirituellen Lebenseinstellung passt. Daraus entsteht die Vorstellung, dass man sich auch über schwerwiegende Ungerechtigkeiten nicht aufregen sollte. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass es auch so etwas wie gesunde Wut gibt – eine moralische Empörung, die aus ethischem Bewusstsein entsteht. Florence Nightingale sprach einmal von einer „heiligen Wut”, die sie zum Handeln trieb, einer tief empfundenen Emotion angesichts von Ungerechtigkeit, die ebenso Teil einer spirituellen Lebenseinstellung sein kann.
Die wertvollen Eigenschaften des Bewusstseins und der Geduld, die uns helfen, mit Schwierigkeiten umzugehen, können auch übergreifen. Sie laden dazu ein, Unbehagen Raum zu geben, können aber ungewollt zu Passivität führen. Es besteht die Gefahr, dass man sich zu lange mit Beschwerden – oder allgemeiner mit Ungerechtigkeit – beschäftigt, ohne zu handeln. Wenn ein Haus brennt, ist es nicht die Zeit für langwierige Überlegungen, sondern es muss zuerst gelöscht werden. Wir erkennen dies auch in unserer eigenen Praxis: Wir selbst haben lange gewartet, bevor wir begonnen haben, uns klar zu äußern, und stellen fest, dass dieses Muster auch bei vielen anderen Praktizierenden vorhanden ist.
Ein fünfter Faktor ist die Möglichkeit, dass existenzielle Weisheit fatalistisch interpretiert wird. In der buddhistischen Psychologie wird den universellen Eigenschaften des Daseins große Aufmerksamkeit geschenkt: Vergänglichkeit, Unbefriedigtheit und Unkontrollierbarkeit. Diese Erkenntnisse können uns helfen, in einer hektischen Welt Frieden zu finden, aber sie können auch zu Gleichgültigkeit führen, wenn sie als Grund dafür genommen werden, nichts mehr ändern zu wollen. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich an das Gebet der spanischen Mystikerin Teresa von Avila zu erinnern: „Gib mir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können.“
Ein weiterer Faktor ist, dass Meditierende oft gute Anpasser sind. In der Praxis lernen wir, uns auf das einzustimmen, was sich uns präsentiert, und darin Harmonie zu suchen. Das ist an sich wertvoll, kann aber auch zu einem Muster des Schweigens in Konfliktsituationen führen. Es kann sich eine Tendenz zur Neutralität entwickeln und eine Zurückhaltung, klar zu sprechen, selbst wenn es eigentlich notwendig wäre.
Schließlich ist das Schweigen amerikanischer Kollegen aus der Dhamma-Gemeinschaft für viele von uns spürbar. Viele von uns sind mit großem Respekt für Lehrer wie Jack Kornfield, Joseph Goldstein und Sharon Salzberg aufgewachsen. Sie waren – und sind – wichtige Inspirationsquellen für viele. Gerade deshalb war es auffällig, dass aus ihrem Lager bisher nur wenige kritische Stimmen zur Gewalt in Gaza zu hören waren. In der Vergangenheit haben sie es geschafft, sich deutlich zu äußern: Wir erinnern uns beispielsweise an die Bilder von Kornfield bei einer Protestaktion gegen das Militärregime in Myanmar im Jahr 2008 oder von Goldstein bei einer Klimademonstration. Auch Anālayo Bhikkhus Beiträge zur Klimadebatte zeigen eine umfassende Vision des Dharma und seiner Integration in das tägliche Leben.
Deshalb plädieren wir dafür, auch in diesem Fall das Offensichtliche beim Namen zu nennen, mit all dem Unbehagen, den Zweifeln und dem Nichtwissen, das damit einhergehen mag. Wir sind daher besonders dankbar für die Worte von Bhikkhu Bodhi, der sich deutlich gegen den Völkermord in Gaza ausspricht. In seinem Essay No Time for Silence (Juli 2024) schreibt er: „Meiner Auffassung nach sollte Gleichmut nicht unsere Fähigkeit zu weisen moralischen Urteilen beeinträchtigen oder unsere Verpflichtung, auf der Grundlage klarer ethischer Überzeugungen zu handeln, negieren. Gleichmut kann leicht mit Mitgefühl koexistieren und gewissenhaftes Handeln begleiten, das darauf abzielt, moralisches Unrecht zu korrigieren.“
3. Beendigung der Gewalt und Streben nach dauerhaftem Frieden
Die Beendigung der Gewalt und die Erreichung eines Waffenstillstands aller beteiligten Parteien ist möglich. Mehr noch, sie ist notwendig. Es ist auch wichtig, erneut nach dauerhaften Lösungen zu suchen, in denen beide Völker friedlich zusammenleben können. Unserer Ansicht nach ist es nicht unangemessen, neben dem bereits bestehenden Staat Israel auf die Schaffung eines palästinensischen Staates hinzuarbeiten.
4. Was können wir als Meditierende tun, um das Schweigen zu brechen?
Wir wollen Dharma-Lehrer, die sich nicht ausdrücklich oder nur allgemein zum Völkermord äußern, nicht verurteilen. Schließlich können wir die inneren Beweggründe anderer niemals vollständig nachvollziehen. Gleichzeitig empfinden wir selbst die Notwendigkeit, nicht wegzuschauen, sondern bewusst das Schweigen zu brechen und aus moralischer Überzeugung zu handeln. Denn Mitgefühl kann auch aktiv sein – nicht nur in der Stille, sondern auch in Wort und Tat.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie wir einen Beitrag leisten können, sowohl durch mitfühlendes Handeln als auch durch meditative Praxis. Alles, was gewaltfrei und mit guter Absicht getan wird, kann, egal wie klein es auch sein mag, dazu beitragen, Gewalt zu verringern und Leiden zu lindern.
4.1. Mögliche Formen von Mitgefühl in Aktion
Informieren Sie sich umfassend, nicht nur über Mainstream-Kanäle wie NOS. Sprechen Sie offen über die Ungerechtigkeit und das Ausmaß des Völkermords, benennen Sie die Perspektive eines palästinensischen Staates und betonen Sie die Bedeutung von Druck von außen – auch durch die Niederlande, beispielsweise durch Sanktionen gegen das israelische Regime.
Sie können sich Organisationen wie Liberation Circle anschließen, einem Forum buddhistischer Praktizierender, die Gerechtigkeit, Mitgefühl und ethisches Handeln fordern.7 Erwägen Sie eine Spende an Hilfsorganisationen, die in Gaza tätig sind, wie UNRWA, Oxfam Novib, Amnesty International und UNHCR. Alternativ können Sie an Ihrem Geburtstag oder zu anderen Anlässen Ihre Freunde bitten, anstelle eines Geschenks an eine Organisation Ihrer Wahl zu spenden.
Sie können auch an Demonstrationen und gewaltfreien Protesten teilnehmen, Petitionen unterschreiben, Briefe oder E-Mails an Politiker schicken und/oder eine Partei wählen, die sich klar kritisch gegenüber der Politik Israels äußert.
Für politisch aktive Menschen gibt es weitere Möglichkeiten, sich für ein Handelsembargo gegen Israel, die Beendigung der akademischen und militärischen Zusammenarbeit und die Beendigung des Waffenhandels einzusetzen.
Darüber hinaus können Sie sich online engagieren, indem Sie Ihre Meinung äußern: Veröffentlichen Sie Beiträge, achten Sie jedoch auf einen angemessenen Ton. Teilen Sie wertvolle Beiträge oder zeigen Sie Ihre Anerkennung durch Likes und unterstützende Kommentare. Der Boykott israelischer Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen ist eine weitere Möglichkeit, moralischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben. Die Website www.bdsmovement.net bietet konkrete Instrumente für Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen, die auf der Prämisse basieren, dass kollektives Handeln das Bewusstsein schärft und Druck auf die Politik ausübt.8
4.2. Was Meditation bewirken kann
Unsere Meditationspraxis kann eine unterstützende Grundlage für klares und mitfühlendes Handeln bilden. Anstatt uns von Gefühlen der Ohnmacht, Wut oder Traurigkeit überwältigen zu lassen, können wir diese mit Freundlichkeit und Achtsamkeit anerkennen. Aus dieser inneren Stabilität heraus können wir bewusster entscheiden, wie wir einen Beitrag leisten wollen.
Im achtfachen Pfad wird „richtiges Begriff” als erster Schritt genannt. Ein wichtiger Aspekt davon ist kammassakāta sammā-ditthi, die Einsicht, dass jeder von uns Erbe seiner Handlungen ist – auch des Nicht-Handelns. Aus dieser Einsicht heraus können wir unterscheiden, was förderlich und verbindend ist und was nicht. In diesem Zusammenhang glauben wir, dass Schweigen angesichts von Völkermord nicht förderlich ist.
Übungen wie Mettā oder Freundlichkeitsmeditation können dabei helfen, Freundlichkeit zu entwickeln – nicht nur gegenüber geliebten Menschen, sondern auch gegenüber Menschen, mit denen Sie möglicherweise Konflikte haben, oder sogar gegenüber Staats- und Regierungschefs. Sie könnten beispielsweise Netanjahu und der Hamas etwas wünschen wie: „Mögen Sie Weisheit entwickeln und frei von gewalttätigen Absichten sein.“ Sie könnten alle Menschen einschließen, die von dieser humanitären Katastrophe betroffen sind, alle leidenden Seelen und Opfer auf beiden Seiten der Grenze zum Gazastreifen.
Tonglen, was wörtlich „empfangen und teilen“ bedeutet, kann ebenfalls hilfreich sein. Bei dieser kraftvollen Meditationsform tibetischen Ursprungs atmen wir bewusst ein wenig vom Leiden anderer Menschen – zum Beispiel der Menschen in Gaza – ein und atmen Liebe, Vertrauen oder Hoffnung aus.9
Erleuchtung oder Erwachen könnte in diesem Zusammenhang als Öffnen der Augen für das, was wirklich in der Welt vor sich geht, sowie als Mut, Werten wie Mitgefühl, Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu folgen, verstanden werden.
Wenn Sie einer Sangha oder einer Meditationsgemeinschaft angehören, könnten Sie dort Initiativen ins Leben rufen, die Raum für Reflexion über die Situation in Gaza und anderen Orten der Gewalt schaffen. In den Niederlanden wurde beispielsweise Anfang Juli die Aktion „Witnessing Gaza“ ins Leben gerufen, bei der ununterbrochen die Namen der in Gaza Getöteten vorgelesen wurden – ein stilles, aber kraftvolles Zeugnis.
Am Ende Ihrer Meditation können Sie eine traditionelle Praxis durchführen, die in Pali pattidāna genannt wird: das Teilen von Verdiensten. Dabei widmen wir die positiven Eigenschaften unserer Meditation Menschen, die unter Gewalt und Unterdrückung leiden – wie die Menschen in Gaza.
Vielleicht bietet ein Gedicht des palästinensischen Dichters Marwan Makhoul einen sinnvollen Abschluss für diesen Artikel:
„Um Poesie zu schreiben, die nicht politisch ist
muss ich den Vögeln lauschen
und um die Vögel hören zu können
müssen die Kampfflugzeuge still sein.”
Möge dieser Artikel all jenen dienen und sie unterstützen, die unter der aktuellen Gewalt in Gaza leiden.

Dieser offener Brief wurde am Montag, dem 7. Juli 2025, von den folgenden Meditationslehrern unterzeichnet, die Vipassanā-Retreats in den Niederlanden und Belgien leiten: Frits Koster, Joost van den Heuvel Rijnders, Katleen Janssens, Ank Schravendeel, Dingeman Boot, Ria Kea und Chris Grijns.